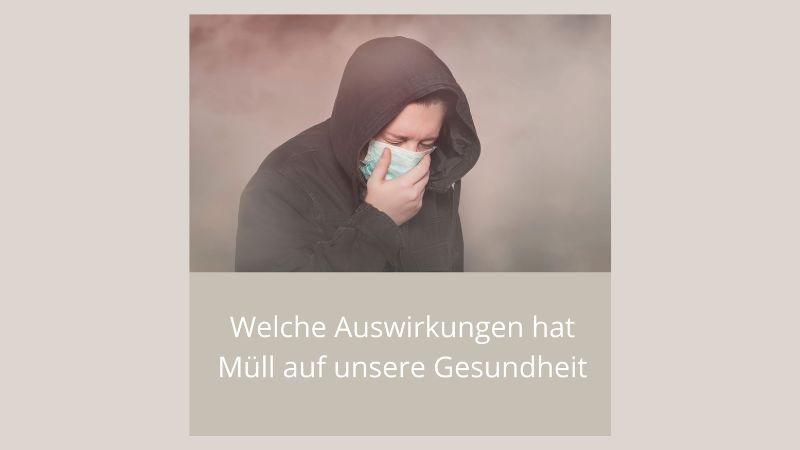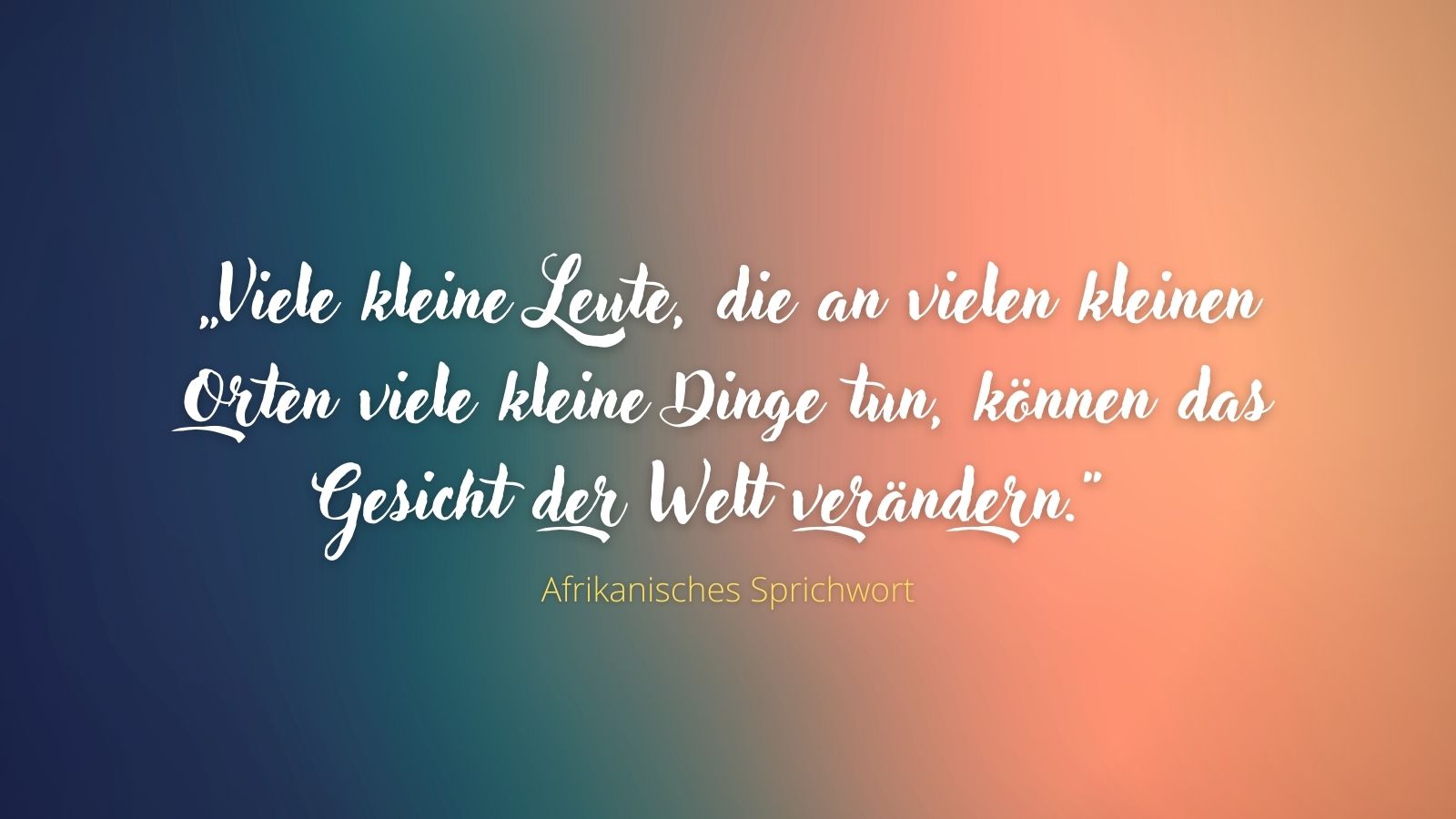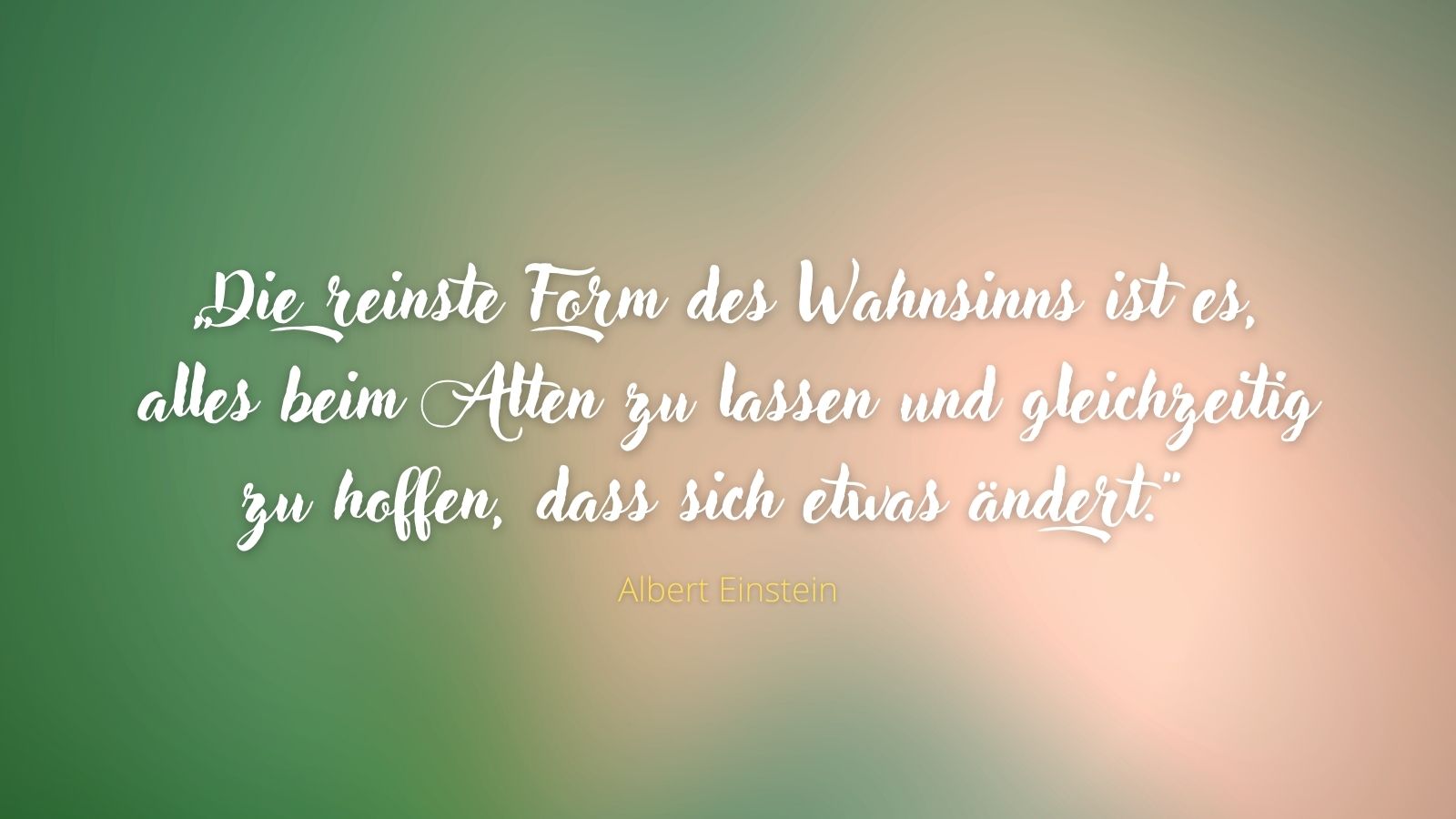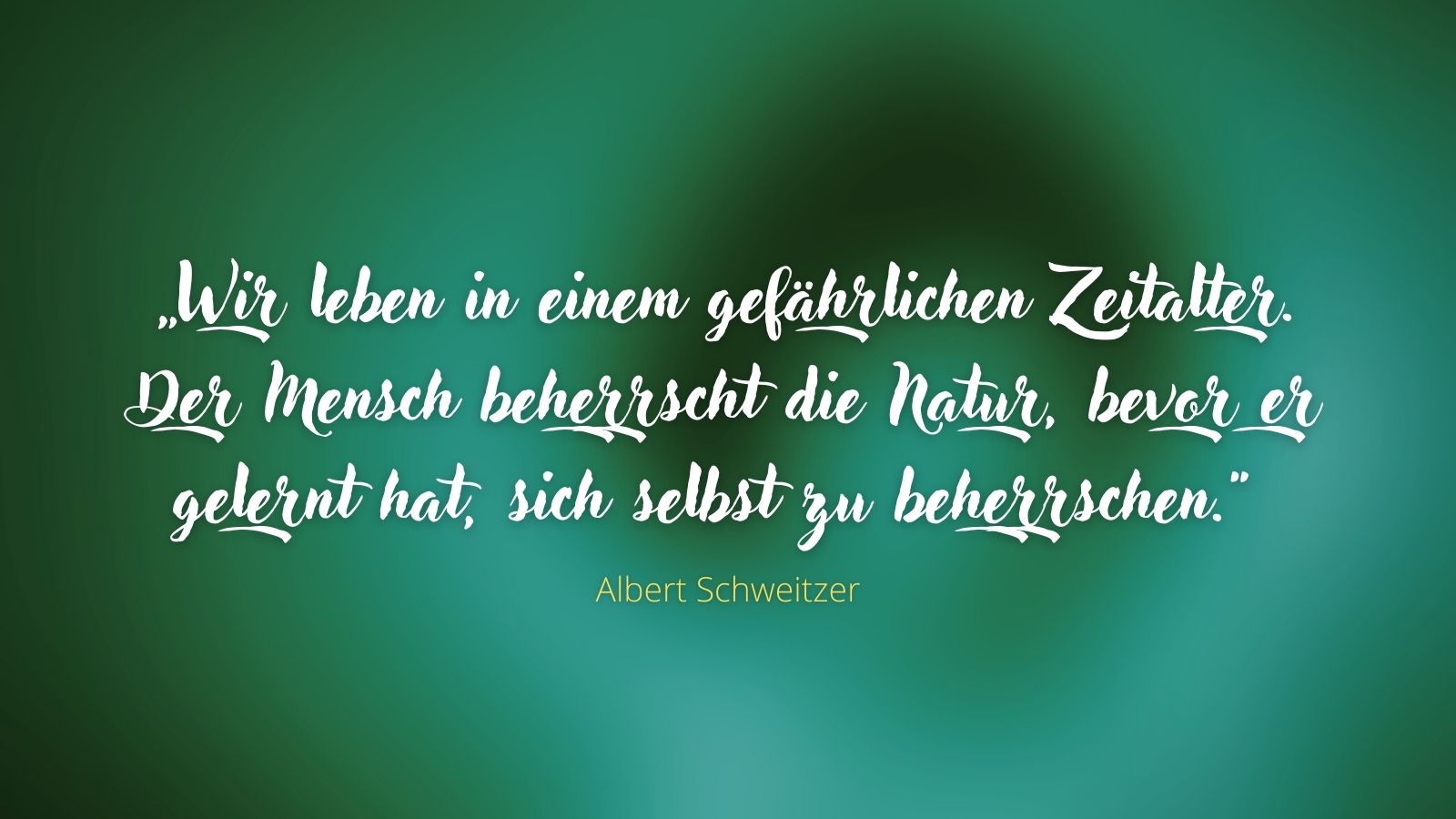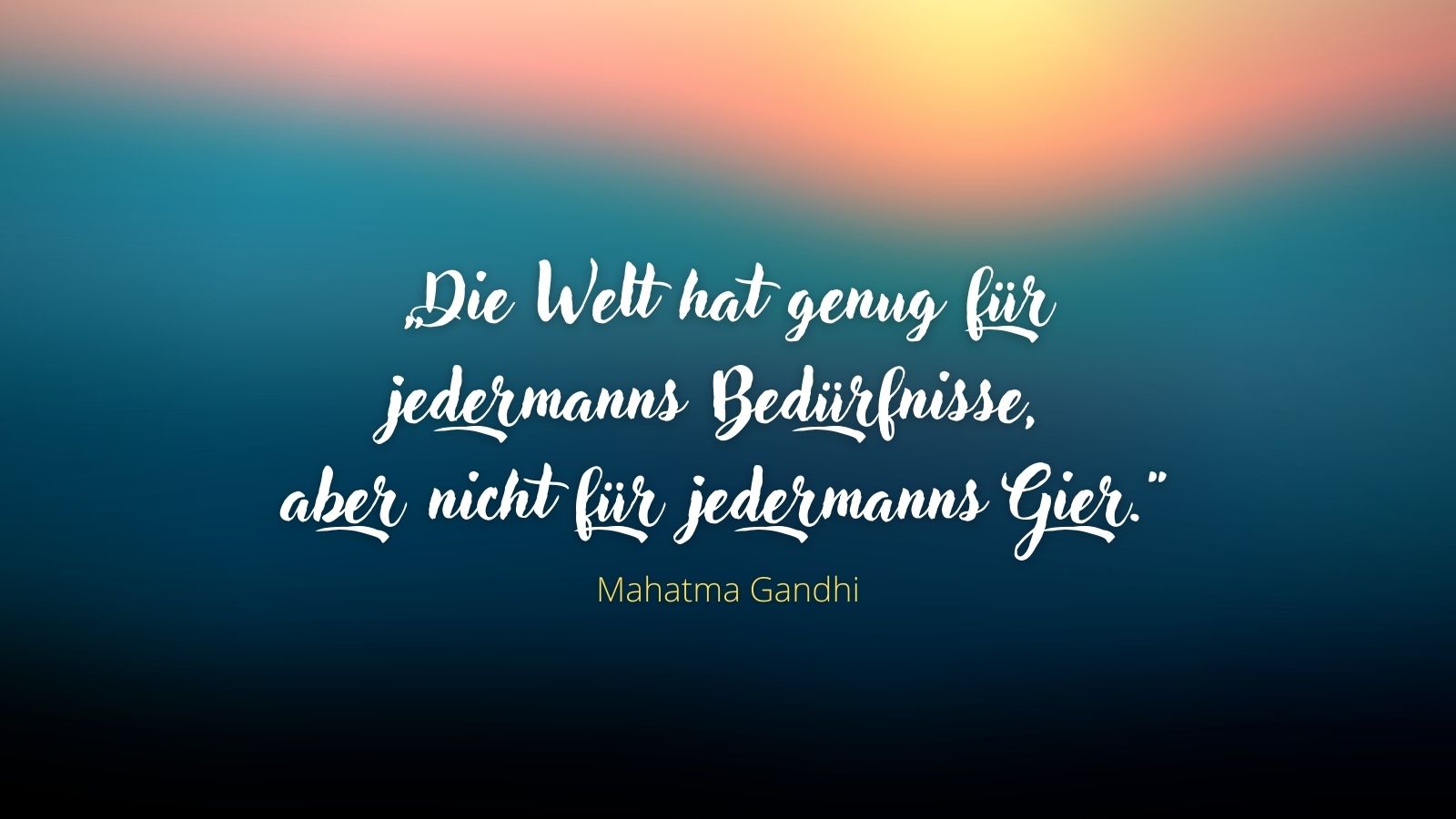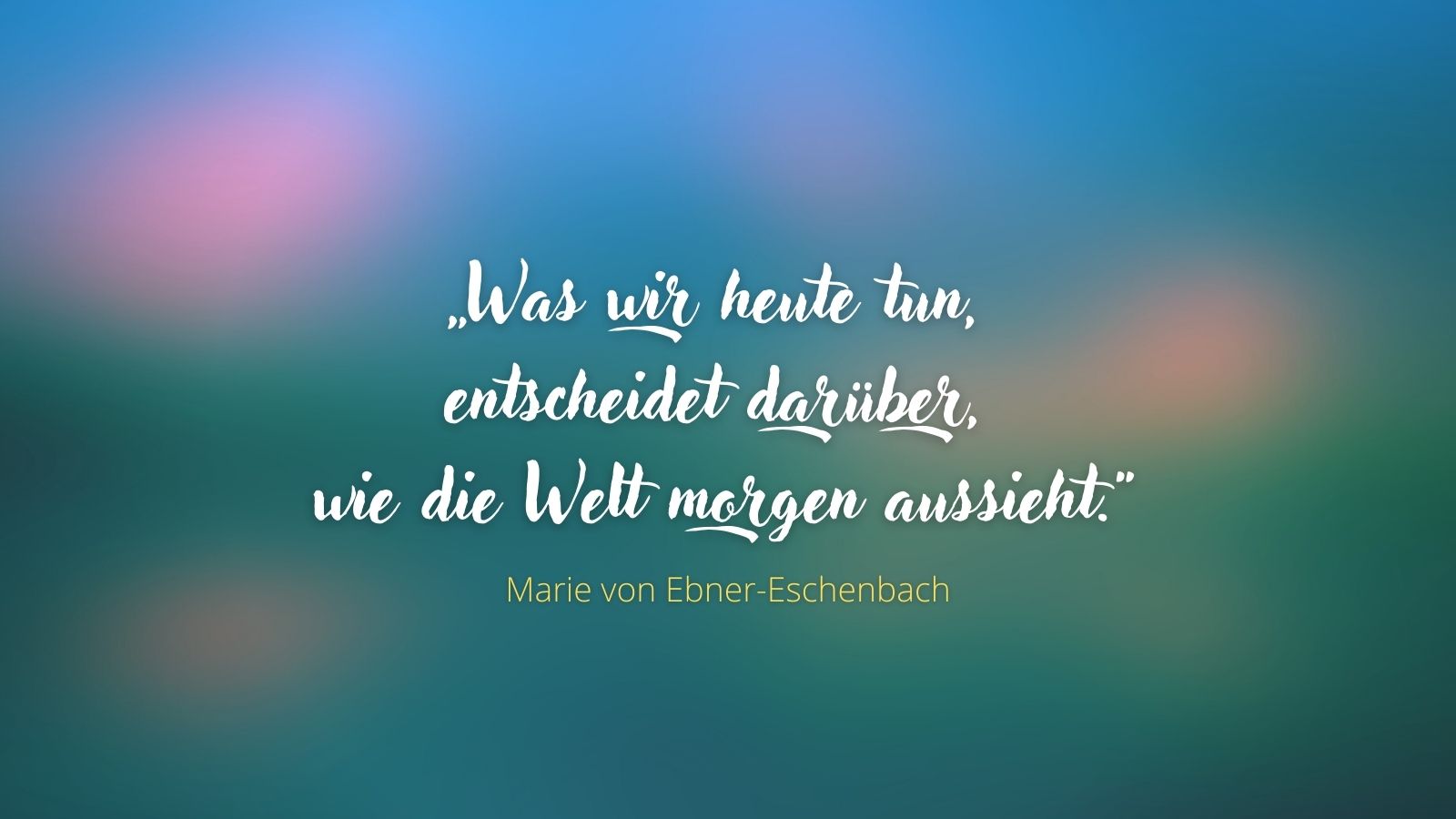Welche Auswirkungen hat Müll auf unsere Gesundheit
Müll ist mehr als nur ein ästhetisches Problem – er kann ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Unsachgemäße Entsorgung und Umweltverschmutzung führen dazu, dass schädliche Substanzen in Luft, Wasser und Boden gelangen, die langfristige Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben können. Doch welche Gefahren birgt Müll genau? Ein Blick auf die wichtigsten Risiken: Wie können wir … Weiterlesen