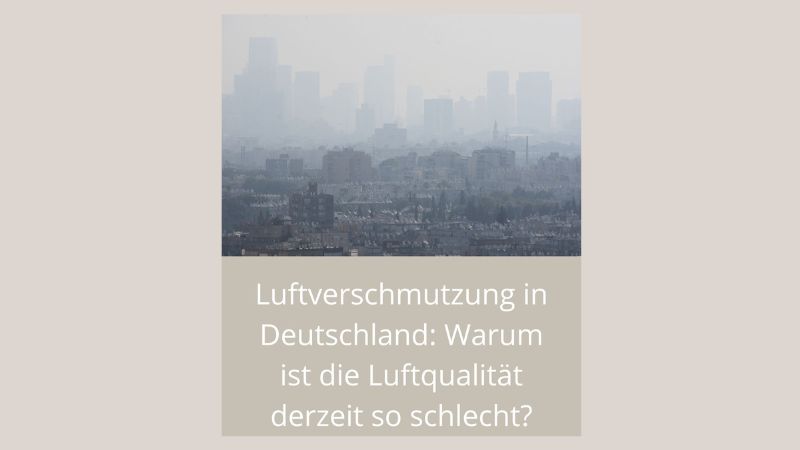Luftverschmutzung in Deutschland: Warum ist die Luftqualität derzeit so schlecht?
In den letzten Tagen haben viele Menschen in Deutschland bemerkt, dass die Luft irgendwie „schwerer“ wirkt – ein Blick auf die aktuellen Luftqualitätswerte bestätigt dieses Gefühl . Feinstaub und Stickstoffdioxid haben in vielen Städten Rekordwerte erreicht, was nicht nur die Sicht trübt, sondern auch ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Doch warum ist das so? Und … Weiterlesen