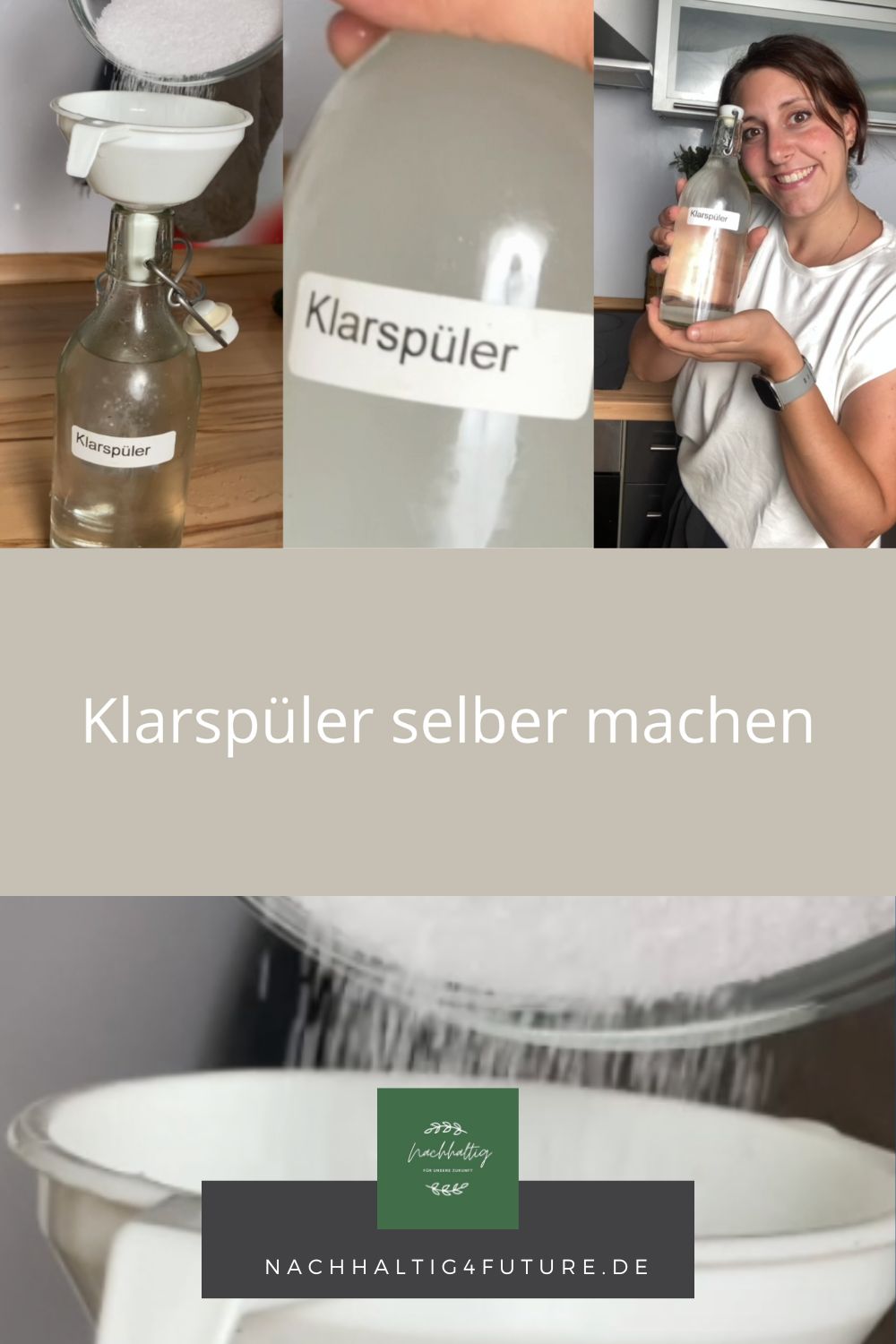Der Weltvegantag findet jedes Jahr am 1. November statt. International genannt: The World Vegan Day. Dieser Tag hat seinen Ursprung in England. Ein Veganer, Donald Watson, hat am 01.11.1944 die „Vegan Society“ gegründet, 50 Jahre später hat man zu ehren dessen den Weltvegantag erschaffen.
Was ist eigentlich vegan?
Veganismus ist eine Lebensweise, auf Fleisch, Lebensmittel oder Produkte tierischen Ursprungs zu verzichten. Eine Entscheidung zum Veganismus kann verschiedene Aspekte und Gründe haben.
Eine Welt, in der Tiere nicht mehr leiden und getötet werden müssen, ist eine Welt, in der auch Menschen in Frieden und Würde leben können.
Beim Veganismus spielt der Aspekt Tierwohl und Ethik eine sehr große Rolle. Viele Jahre wurden Tiere nur als Objekte angesehen, ohne Gefühle. Erst 1990 wurde ein Gesetz geschaffen, dass Tiere keine Sachen sind, sondern Lebewesen. Auch ein Tierschutzgesetz gibt vor, dass jedes Tier ein artgerechtes Leben ohne Leid und Schmerz verdient hat.
Doch sehen wir uns den Fleischkonsum, allein in Deutschland an, so isst jeder Deutsche durchschnittlich 60 kg Fleisch im Jahr. Viel zu viel, um den Tieren das zu bieten, zu können, was sie auch verdient haben. Aus diesem Grund werden immer noch viele Tiere in Massentierhaltung gehalten. Auf engsten Raum, in engen Käfigen ohne Tageslicht. Am Ende dieses Lebens folgt dann die Hinrichtung.
Doch nicht nur als Fleischlieferant dienen die Tiere für uns Menschen. Auch für ihre Produkte wie Felle, Milch, Honig oder Eier werden Tiere extra gezüchtet. Genauso ist es mit Tierversuchen.
Auch Umweltschutz ist beim veganen Leben gar nicht so unbedeutend. Dass ein Tier leidet, ist vielen klar, doch dass auch wir Menschen und vor allem unsere Umwelt darunter leiden, wissen die wenigsten.
Welthunger ist da natürlich ein großes Stichwort, denn laut WFF gäbe es genug Essen für alle auf dieser Erde. Doch wird mehr als die Hälfte der weltweiten Getreideernte als Kraftfutter, zum Mästen der Tiere verwendet. Somit bleibt dem Menschen nur wenig als Lebensmittel übrig. Weitere Probleme der Massentierhaltung ist der hohe Verbrauch an Ressourcen wie Energie und Wasser, hoher CO2- und Methan Ausstoß sowie Antibiotikaresistenzen und Zoonosen.
In manchen Kulturen oder Religionen wie z.B. Buddhismus wird auf Fleisch verzichtet.
Mit einer veganen Ernährung kann man also vieles Positives bewirken. Genau deswegen wird dieser Tag auf der ganzen Welt gefeiert.
Wo und wie wird dieser Tag gefeiert?
In verschiedenen Großstädten gibt es Aktionen wie Aktionstage oder -Wochen bei denen veganes Essen hergestellt wird, Infostände oder andere Projekte um auf eine vegane Lebensweise aufmerksam zu machen.
Du kannst auch selber an diesem Tag, deinen Lebensstil überdenken und ein veganes Rezept probieren oder dir Informationen holen zu Themen vegan.
Es ist nicht nur unmoralisch, Tiere zu essen, es ist auch unklug. Es ist weder notwendig noch gesund, und es setzt uns der Gefahr aus, die Umwelt zu zerstören und die Ressourcen der Erde aufzubrauchen.
Mehr Infos und Rezepte findest du auf unserem Blog zum Thema Veganes Leben.