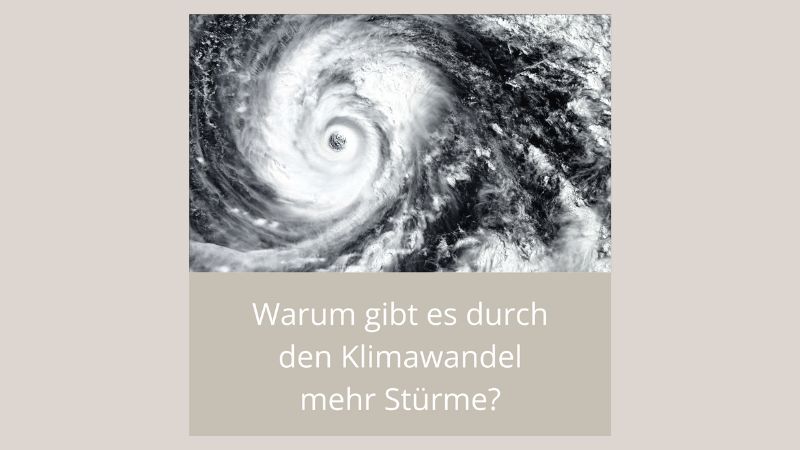Plastikmüll und seine Folgen
Unsere Umwelt wird täglich mit einer enormen Menge an Plastikmüll belastet – und das hat weitreichende Folgen für Natur, Tierwelt und auch uns Menschen. In diesem Artikel beleuchten wir, warum trotz aller Warnungen immer noch so viel Plastik im Müll landet und welche Mechanismen dahinterstecken. Woher stammt der meiste Plastikmüll? Studien und Expertenberichte zeigen, dass … Weiterlesen